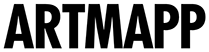Unsere Website verwendet notwendige Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Weitere Informationen darüber finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit der Nutzung dieser Seiten geben Sie Ihr Einverständnis, dass wir notwendige Cookies verwenden.
Ja, ich stimme zu.
Artists
Künstlerporträts
Bildergalerie
Christiane Möbus
und Timm Ulrichs
Mausklick für Ganzseitendarstellung
mit Bildlegende
Christiane Möbus und Timm Ulrichs in Wolfenbüttel und Celle
Hannovers
künstlerische Doppelspitze
Die Hannoveraner Künstler Christiane Möbus und Timm Ulrichs sind aktuell in gleich drei Ausstellungen der Region zu sehen: Im Kunstverein Wolfenbüttel Christiane Möbus „Sisyphos“ bis 18. Januar 2026 und im Celler Schloss Christiane Möbus und Timm Ulrichs „Paarlauf“ bis 4. Januar 2026; empfehlenswert ist auch der Besuch des Timm-Ulrichs-Kabinett im Kunstmuseum Celle.
Seit gut einem halben Jahrhundert sind Timm Ulrichs und Christiane Möbus so etwas wie die beiden Aushängeschilder für „Kunst aus Hannover“. Seit den 1960er-Jahren nämlich mischt Timm Ulrichs mit seiner Konzeptkunst die Kunstszene nicht nur im deutschsprachigen Raum auf; etwa zehn Jahre später betrat Christiane Möbus mit ihren so poetischen wie oft rätselhaften Skulpturen und Objekten die Bühne der internationalen Kunstwelt.
Also der Reihe nach: Seit 1959 ist der 1940 in Berlin geborene Timm Ulrichs in Hannover als selbst ernannter „Totalkünstler“ tätig. Zwei Jahre später erklärte er sich, und hiermit ist der Begriff „Totalkunst“ bereits präzise definiert, sitzend auf einem Stuhlpodest als „erstes lebendes Kunstwerk“ und gründete zudem seine „Werbezentrale für Totalkunst und Banalismus“. Dieses „lebende Kunstwerk“ bezog in der Folge immer wieder seinen eigenen Körper in seine Arbeiten ein, und dies durchaus mit hohem Risiko für das eigene Leben. Anlässlich der Olympischen Spiele in München 1972 stellte der „documenta 6“-Teilnehmer zum Beispiel seine „Olympische Marathon-Tretmühle“ auf, in der er selbst mit ganzem Körpereinsatz auf der Stelle lief. Fünf Jahre später schnallte er sich einen Blitzableiter um den Bauch und lief während eines Gewitters nackt auf einem Feld umher. 1978/1980 dann legte er sich als „Findling“ für zehn Stunden in einen Granitblock, der mit seiner Körperform ausgehöhlt war. So gelang es Ulrichs, die Mehrdeutigkeit des Wortes „Findling“ − gefundenes Kind und solitärer Stein aus der Eiszeit − eindrucksvoll zu visualisieren. Und 1981 ließ der umtriebige Künstler sich die Worte „The End“ vielsagend auf sein rechtes Augenlid tätowieren. „Die Augen schließen“ als metaphorischer Ausdruck für den Tod wird so vom Künstler lapidar, aber überzeugend neu interpretiert.
Bereits 1970 fand Timm Ulrichs’ erste „Totalkunst-Retrospektive“ im Krefelder Museum Haus Lange statt, es folgten größere Einzelausstellungen unter anderem in Madrid, Antwerpen und natürlich in Hannover. 2020 schließlich fand im Berliner Haus am Lützowplatz anlässlich seines 80. Geburtstags die Ausstellung „Ich, Gott & die Welt“ statt, die 100 Tage lang um jeweils ein Werk des Künstlers wuchs, also erst am Ende der Ausstellung für nur einen Tag komplett war. 1972, um den kurzen biografischen Abriss zu beenden, trat Ulrichs seine Professur an der Kunstakademie Münster an, die er bis 2005 innehatte.
Legendär bis heute ist Ulrichs’ Vermählung mit Anna Blume, also jener Kunstfigur, die der hannoveranische MERZ-Künstler Kurt Schwitters 1919 mit seinem damals an Litfaßsäulen angeschlagenen Gedicht „An Anna Blume“ erfand. Diese Vermählung gab Ulrichs 1967 in Form einer Heiratsanzeige, die er in einer hannoveranischen Tageszeitung annonciert hatte, bekannt. Diese Hommage an Kurt Schwitters und an das „tropfe Tier“ Anna Blume, deren Vorname man „auch von hinten lesen kann“ (Schwitters), zählt zu den zahlreichen Werken, die Ulrichs immer wieder für den öffentlichen Raum realisiert hat. Und die eine strikte Trennung von Kunst und (Liebes-)Leben schwierig machen.
Während der „Art Cologne“ 1975 sorgte Ulrichs, der auch dafür bekannt ist, dass sein Ausstellungsaufbau oftmals erst während der Eröffnungsreden wirklich beendet ist, mit einer durchaus provozierenden Performance für Aufsehen: Wie immer in Schwarz gekleidet flanierte er mit Blindenstock, dunkler Brille, gelber Armbinde und einem umgehängten Schild durch die gut besuchten Messehallen. Auf dem Schild stand zu lesen: „Ich kann keine Kunst mehr sehen“. So nahm der Kunstprofessor und „Totalkünstler“ eindeutig, aber auch selbstironisch, Stellung zur zunehmenden Kommerzialisierung der bildenden Kunst.
Christiane Möbus zählt seit den 1980er-Jahren zu den damals noch wenigen international erfolgreichen deutschen Bildhauerinnen. Geboren 1947 in Celle, ging die Künstlerin 1970 nach ihrem Studium an der Hochschule für Bildende Kunst Braunschweig erst einmal als junge Stipendiatin nach New York. Im „Big Apple“ entstanden in diesen zwei Jahren Arbeiten, die damals als „Women Concept Art“ bezeichnet wurden, so zum Beispiel ihre Papierarbeit „Just a Poem“ (1970). In einem US-amerikanischen Lexikon hat Möbus für diese Textarbeit nach politisch relevanten Frauenfiguren aus der Geschichte gesucht. Signifikanterweise − Stichwort: Patriarchat − hat sie in dem ganzen Buch dazu aber nur drei (!) Frauennamen gefunden. Auf gelben Notizpapier hat die Künstlerin dann unzählige Männernamen lapidar aufgeführt, dazwischen sind, in trotzigem Rot markiert, die besagten drei Frauennamen zu lesen. Überaus politischer Natur also ist die konzeptuelle Kunst der jungen Christiane Möbus, denn immer wieder beschäftigte sich diese mit Themen wie Ökologie und Feminismus.
Später dann werden die Arbeiten der Künstlerin, die seit 1982 auch als Professorin tätig ist, erst in Braunschweig, später in Berlin, poetischer, objekthafter und daher auch materialaufwendiger. Ein gutes Beispiel hierfür ist ihre Skulptur „Küsse vom König“ (2001/2007): Eine ausgestopfte Giraffe schwebt, stehend auf einem luftigen Stahlpodest und an Stahlseilen hängend, in der Luft. Geheimnisvoll bleibt dieses Denkbild, inhaltlich auflösen lässt es sich nicht und der Titel stiftet ebenfalls gedankliche Unruhe. Auch die Arbeit „rette sich wer kann“ (2001) irritiert nachhaltig, liegen doch da zwei identische Rettungsschiffe aus Holz auf dem Boden, auf dem Trockenen also, voll beladen mit Heuballen. Seenotrettung und Landwirtschaft, aber ebenso Verdoppelung und „falsche“ Verortung treten hier in einen widerspruchsvollen Dialog. Beide Arbeiten waren übrigens in der Ausstellung „Südwärts über den Nordpol“ zu sehen, die 2022 im Sprengel Museum Hannover anlässlich des 75. Geburtstages der Künstlerin stattfand. Das Schlusswort darum von der Kuratorin dieser Schau Gabriele Sand: „Möbus analysiert Natur und Kultur, ihre Arbeiten sind so einfach wie spektakulär, ihr Werk ist eigensinnig und widerständig, es verweigert sich einer voreiligen Interpretation“. Gut so!
Raimar Stange
Bis 18. Januar.2026
Christiane Möbus
Sisyphos
Kunstverein Wolfenbüttel
15. November 2025 bis 4. Januar 2026
Christiane Möbus & Timm Ulrichs
Paarlauf
Gotische Halle im Celler Schloss
Timm-Ulrichs-Kabinett
im Kunstmuseum Celle mit Sammlung Robert Simon
Bis 22. Februar 2026
Das Kunstmuseum Celle feiert 25. Geburtstag
„Kometen. Lichtkunst mit Stahlkraft“
........…....
11/2025